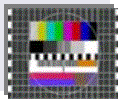
Neues Jugendschutz-Modell
Seit dem 1. April gilt der neue
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
Von Dr. Matthias Kurp, 02.04.2003

Mehr als zwei
Jahre lang haben Politiker, Medienexperten und Fachverbände um einen gemeinsamen
Jugendschutz-Rahmen für alle Massenmedien gerungen. Heraus kam das Modell der
„regulierten Selbstregulierung“, das am 1. April in Kraft trat. Jetzt muss sich
das Kompromisspaket in der Medienwirklichkeit bewähren...
Bereits im Juni 2002 hatten Bundestag und Bundesrat die Weichen für die Neuregelung des Jugendschutzes gestellt: Die künstliche Trennung zwischen Telediensten (Bundeszuständigkeit) und Mediendiensten (Kulturhoheit der Länder) war dabei aufgehoben und die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften in ihrem Kompetenzbereich aufgewertet worden. Die Bonner Behörde heißt nun Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und kann seit 1. April auch ohne entsprechenden Antrag Print-, Tele- (Internet) oder Trägermedien (CDs, DVDs, Videos) indizieren.
Von der Bundesprüfstelle indizierte Filme dürfen auch von Programmanbietern im Rundfunk nicht ausgestrahlt werden. Für alle anderen Fälle ist im privat-kommerziellen TV-Bereich weiterhin die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) zuständig. Für das Internet wurde 1997 die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia (FSM) gegründet. Problematisch an der alten Regelung war allerdings, dass für das Fernsehen ganz andere Bedingungen galten als für Online-Medien. Grund dafür waren unterschiedliche Zuständigkeiten. Während Rundfunkprogramme und an die Allgemeinheit gerichtete Internet-Inhalte im Rahmen von Rundfunk- bzw. Mediendienstestaatsvertrag von den Landesmedienanstalten bzw. den Landesjugendbehörden (jugendschutz.net) kontrolliert wurden, zählten zum Beispiel Erotik-Downloads zu den weniger streng regulierten Telediensten, für die der Bund zuständig war.
Ü
Neue Kommission für Jugendmedienschutz
Parallel zum im Juni 2002
verabschiedeten Jugendschutzgesetz
sorgt der im August beschlossene Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
nun für einen einheitlichen Rechtsrahmen. Beide Regelwerke traten am 1. April
in Kraft. Das neue Modell setzt vor allem darauf, dass sich die Medienbranchen
weiterhin selbst regulieren. Allerdings müssen sich die Selbstkontrolleure
durch eine neue Institution zertifizieren und kontrollieren lassen.
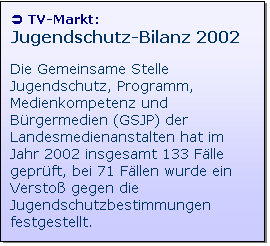 Zu diesem Zweck wurde am 2.
April in Erfurt die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) gegründet. Das neue
Gremium hat zwölf Mitglieder (plus zwei Stellvertreter), von denen die Hälfte
aus dem Kreis der Landesmedienanstalten stammen, die mit dem Präsidenten der
Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), Wolf-Dieter Ring, und dem
Direktor der Hamburgischen Anstalt für neue Medien (HAM), Lothar Jene, auch den
Präsidenten und seinen Stellvertreter stellen.
Zu diesem Zweck wurde am 2.
April in Erfurt die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) gegründet. Das neue
Gremium hat zwölf Mitglieder (plus zwei Stellvertreter), von denen die Hälfte
aus dem Kreis der Landesmedienanstalten stammen, die mit dem Präsidenten der
Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), Wolf-Dieter Ring, und dem
Direktor der Hamburgischen Anstalt für neue Medien (HAM), Lothar Jene, auch den
Präsidenten und seinen Stellvertreter stellen.
Die Länder sind darüber hinaus
durch zwei Experten vertreten, während der Bund nur zwei Mitglieder ernannte,
darunter Elke Monssen-Engberding als Chefin der Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien.
In den nächsten Monaten soll die
KJM Satzungen und Richtlinien erlassen, an denen sich die
Selbstkontrolleinrichtungen orientieren müssen. Dabei handelt es sich um Regeln
zum Beispiel zur Festlegung der Sendezeit von Filmen, die für Jugendlich
ungeeignet sind, oder die Festlegung der Zuständigkeit bei Prüfverfahren. Für
den Rundfunksektor sollen die Landesmedienanstalten spezielle Richtlinien und
Satzungen zur Verschlüsselung und Vorsperrung digitaler Angebote verabschieden.
Pornos sind im deutschen Fernsehen aber auch weiterhin verboten.
Ü
Verbot einzelner Filme problematisch
Immer wieder kritisiert wurde an
der „regulierten Selbstregulierung“, dass der Bewertungsspielraum der
Selbstkontrolleure nach wie vor sehr groß bleibt, ohne dass die Kommission für
Jugendmedienschutz in Einzelfällen effektiv intervenieren kann. Der
Staatsvertrag erlaubt der KJM nämlich nur sehr begrenzt, Entscheidungen einer
Selbstkontrolleinrichtung inhaltlich zu überprüfen oder gar zu kassieren.
Möglich wäre nur der komplette Widerruf der Zertifizierung einer gesamten
Selbstkontrollinstanz, der aber nicht wegen einzelner Fälle begründet werden
kann.
Bereits in der Vergangenheit hat
die FSF immer wieder leicht modifizierte Versionen von Filmen zugelassen, die
zuvor von der Bundesprüfstelle indiziert worden waren. So wurde die
Ausstrahlung von Horror- und Gewaltstreifen wie „Martial Law“ oder „Death Wish“
bei Premiere erst durch ein Veto der Hamburgischen Anstalt für Neue Medien
unterbunden. Zukünftig wäre dies wohl nicht mehr möglich. Die im neuen
Jugendschutz verankerte Strafe für Ordnungswidrigkeiten wie das Senden
indizierter Filme liegt bei bis zu 500.000 Euro. Doch während früher die
Landesmedienanstalten trotz einer FSF-Freigabe Bußgeldverfahren einleiten
konnten, kann die KJM, solange eine FSF-Entscheidung „vertretbar“ ist, jetzt
nicht mehr einschreiten. Die Zukunft wird zeigen, ob dieses Modell zum
gesellschaftlich verantwortbaren Erfolg führt. Nach fünf Jahren, so ist
zunächst geplant, soll die KJM eine erste Bilanz der regulierten
Selbstregulierung ziehen.
Ü Hier finden Sie eine Auflistung der KJM-Mitglieder.